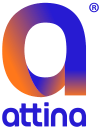Was gilt für Verleiher und Zeitarbeitskräfte?
Die Kündigungsfristen im Zeitarbeitsverhältnis spielen eine zentrale Rolle für die Planbarkeit und rechtliche Absicherung sowohl auf Seiten der Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher) als auch der eingesetzten Arbeitskräfte. Aufgrund der besonderen arbeitsrechtlichen Struktur der Arbeitnehmerüberlassung gelten einige branchenspezifische Besonderheiten, die sich unter anderem aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), den Branchentarifverträgen sowie betrieblichen Vereinbarungen ergeben.
Allgemeine gesetzliche Grundlagen
Grundsätzlich regelt §62 des BGB die ordentlichen Kündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse. Demnach können Arbeitsverhältnisse mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende gekündigt werden. Für Arbeitgeber verlängert sich die Kündigungsfrist bei längerer Betriebszugehörigkeit schrittweise, beginnend mit zwei Jahren (ein Monat) bis hin zu sieben Monaten bei einer Zugehörigkeit von zwanzig Jahren oder mehr. Diese Regelung gilt auch für die Zeitarbeit, sofern keine tarifvertraglichen Ausnahmen greifen.
Tarifliche Besonderheiten in der Zeitarbeit
In der Zeitarbeitsbranche gelten hauptsächlich die Tarifwerke des BAP/DGB oder des iGZ/DGB. Beide Tarifverträge sehen teils abweichende Kündigungsregelungen vor, insbesondere in den ersten Monaten des Arbeitsverhältnisses:
- In der Probezeit, die in der Regel sechs Monate beträgt, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Werktagen gekündigt werden.
- Nach der Probezeit gelten stufenweise steigende Kündigungsfristen, die sich ebenfalls an der Betriebszugehörigkeit orientieren. Die tariflich vereinbarten Fristen können jedoch in bestimmten Punkten von den gesetzlichen Regelungen abweichen, was sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von Vorteil oder Nachteil sein kann.
Kündigungsfristen während eines Einsatzes beim Entleiher
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass ein Einsatzende beim Kundenbetrieb automatisch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Das ist rechtlich nicht korrekt: Das Arbeitsverhältnis besteht zwischen Zeitarbeitskraft und Verleiher, nicht mit dem Entleiher. Wird ein Einsatz beendet, muss das Zeitarbeitsunternehmen die Arbeitskraft weiterbeschäftigen oder freistellen, sofern keine Kündigung ausgesprochen wurde.
Eine Kündigung wegen Wegfalls des Einsatzes ist nur zulässig, wenn keine anderweitige Einsatzmöglichkeit besteht und dies auch dokumentiert werden kann. Selbst dann müssen die geltenden Kündigungsfristen eingehalten werden.
Außerordentliche Kündigung
Neben der ordentlichen Kündigung besteht auch die Möglichkeit einer außerordentlichen (fristlosen) Kündigung. Diese ist jedoch nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Es muss ein wichtiger Grund vorliegen, der eine Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar macht. Beispiele sind schwerwiegende Pflichtverletzungen, Diebstahl oder fortgesetzte Arbeitsverweigerung. Eine vorherige Abmahnung ist in den meisten Fällen erforderlich.
Kündigungsfristen und Kurzzeiteinsätze
Zeitarbeitskräfte werden häufig für kurzfristige Projekte eingesetzt. Dennoch sind die gesetzlichen oder tariflichen Kündigungsfristen einzuhalten. Ein Arbeitsvertrag kann nicht allein deshalb mit verkürzter Frist beendet werden, weil der Auftrag beim Kunden endet. Eine Verkürzung der Kündigungsfrist ist nur bei sachlicher Begründung und in Abstimmung mit den tariflichen Vorgaben möglich.
Besonderheiten bei befristeten Verträgen
Auch in der Zeitarbeit sind befristete Arbeitsverträge üblich. Endet ein solcher Vertrag automatisch zu einem bestimmten Datum oder nach Projektende, ist keine Kündigung erforderlich. Wurde jedoch ein ordentliches Kündigungsrecht vertraglich vereinbart, gelten wiederum die einschlägigen Kündigungsfristen.
Rechte und Pflichten im Kündigungsprozess
Wird eine Kündigung ausgesprochen, gelten folgende Punkte:
- Sie muss schriftlich erfolgen; eine mündliche Kündigung ist unwirksam.
- Die Kündigungsgründe müssen auf Verlangen mitgeteilt werden (insbesondere bei außerordentlicher Kündigung).
- Die Fristen beginnen mit Zugang der Kündigung.
- Eine Kündigungsschutzklage kann innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingereicht werden.
Fazit: Klarheit und Transparenz sind entscheidend
Die Kündigungsfristen im Zeitarbeitsverhältnis unterliegen sowohl gesetzlichen als auch tariflichen Regelungen, die mitunter komplex ineinandergreifen. Um Missverständnisse und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, ist eine transparente Kommunikation zwischen Verleiher, Arbeitnehmer und ggf. dem Entleiher unverzichtbar. Eine rechtssichere Vertragsgestaltung, die Einhaltung tariflicher Vorgaben und ein strukturierter Kündigungsprozess sind für Zeitarbeitsunternehmen unerlässlich.